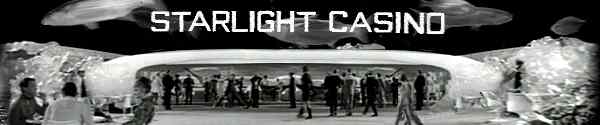Macher Inspirationen
GSD - Informationsamt
Blick zurück in die Zukunft
Die taube Nuß flog wirklich
Zeitgeschichte in "Raumpatrouille - Die phantastischen Abenteuer des Raumschiffes ORION"
Ob hypermoderne Technologie oder ordinäre Modeströmung - in Drehbücher
fließt alles ein, was die Schreiber beschäftigt, ob gewollt oder per
Hinterkopf:
Der Unterwasserwohnungsbau ist gerade erst erfunden... ein Satellit,
eine "taube Nuß", stört auf wichtigen Funkfrequenzen... die Regierung
sucht sich ein ruhiges Plätzchen um nach dem großen Weltenbrand
weiterregieren zu können...
Sind das Szenen aus "Raumpatrouille", dem fernen Jahr 3000?
Mitnichten: Das alles ist (bundesdeutscher) Alltag Anfang der 1960er!
Kalter Krieg und der Wettlauf ins All - Daran denken die meisten wenn
sie zu ergründen suchen was in den Köpfen der Drehbuchschreiber vorging.
Aber da war viel mehr!
Gehen wir 40 Jahre zurück in die Zeit um 1960:
Wirtschaftswunderland hatte kaum Arbeitslose und rief die ersten
Gastarbeiter ins Land. Den "Italiener um die Ecke" sucht man lange,
dafür spielen die Beatles gerade in Hamburg und Elvis leistet seinen
Wehrdienst in Deutschland. Adenauer ist noch Bundeskanzler, Berlin trennt
bald eine Mauer vom Rest der "Ostzone". 007 und Winnetou werden demnächst
durchs Kino reiten. Kein 68er revoltiert gegen den Muff und Mief von
Heimatfilmen. Den PC gab es nicht - nur bei wenigen Großkonzernen standen
klobige Schränke die kaum einer zu Gesicht bekam. Der Sputnik umkreiste die
Erde, Perry Rhodan erreichte den Mond und - wahrhaft revolutionär - der
Kugelschreiber wird erfunden.
Das ist die Zeit in der Rolf Honold das Konzept für die Raumpatrouille
ausarbeitete, welches 1962 von der Bavaria in München angenommen wurde.
Da noch weitere Jahre vergingen bis die Dreharbeiten begannen (März 1965),
müssen wir den Zeitraum von Ende der 50er bis ca. 1964 betrachten um
herauszufinden, welche Ereignisse und Strömungen der damaligen Zeit ins
Drehbuch einflossen.
"Es gibt keine Nationalstaaten mehr..."
Erdenken wir eine Welt in der es keine Nationalstaaten mehr gibt, wie es im
Vorspanntext der Raumpatrouille so schön heißt.
Der Gedanke an eine Weltregierung war 1960 nicht mehr neu in der SF. Aber es
bestand damals einiger Grund zum Optimismus, daß es die Menschheit
tatsächlich einmal soweit bringen könnte.
1957 bereiteten die Römischen Verträge die Gründung der Europäische
Wirtschafts-Gemeinschaft (EWG) ein Jahr später vor. 1960 folgten
beispielsweise OPEC, EFTA und die Welthandelsorganisation OECD, später
die afrikanische OAU.
Adenauer und de Gaulle unterzeichneten 1963 die deutsch-französischen
Verträge. Die einstigen "Erbfeinde" Deutschland und Frankreich werden
für lange Zeit der Motor der europäischen Einigung sein. Eine
TV-Koproduktion zur Realisierung der "Raumpatrouille" zwischen der
deutschen Bavaria und der französischen ORTF war zu jener Zeit
eigentlich ein logischer Schritt zur Normalität.
Emanzipation im All - Sowjetische Raumfahrt
Die Pioniertage der Raumfahrt haben die SF beflügelt und damals war eine
Menge los im All. Die Sowjetunion startete den ersten Satelliten
(Sputnik I, 10/57), brachte das erste Lebewesen in eine Erdumlaufbahn
(Hund Laika an Bord von Sputnik II, 11/57) und katapultierte den ersten
Menschen, Juri Gagarin, ins All (Wostok I, Anfang 1961).
Da man dem Westen keinerlei Erstleistung zugestehen wollte, mußte neben
den männlichen Kosmonauten unbedingt auch die erste Frau im All eine
Russin sein.
Das war am 16.6.1963 Valentina Tereschkowa an Bord von Wostok 6.
Der "Daily Express" in London jubelte: "Für die Millionen
benachteiligter Frauen der Welt ist sie ein hohes Symbol weiblicher
Emanzipation."
Man darf leise Zweifel anmelden. Obwohl Tereschkowa zwei Tage später als
ihr (männlicher) Kollege mit Wostok 5 zum Gruppenflug startete,
"durfte" sie aber 3 Stunden eher landen als er. So ganz allein wollte
man die Frau Kosmonautin wohl nicht da oben lassen.
Bis in die 80er brach keine andere Frau mehr zu den Sternen auf. So
richtig viel hatten die Ur-Ahnen von GSD-Leutnant Tamara Jagellovsk
nicht zu melden.
Jedoch - die Emanzipation war längst im Gange. Einige europäische
Staaten waren weiter, andere noch im aufholen. Mit dem
Gleichberechtigungsgesetz paßt man in Deutschland 1957 das BGB endlich
an die im Grundgesetz schon immer festgelegte Gleichberechtigung von
Mann und Frau an.
Revolutionär die Vorgänge im Schweizer Kanton Genf im März 1960: Das Frauenwahlrecht wird eingeführt.
1964 sah man in Deutschland die ersten Politessen.
Frauen in Führungspositionen waren damals noch weit seltener als heute,
aber es deutete sich schon an, daß die Zeit für General Lydia van Dyke
eines Tages kommen würde.
Der Mond war ab 1959 das Ziel der sowjetischen Sonden Lunik I - III.
1962 wurde die Venus anvisiert, erst 1965 auch der Mars. Außer
Umlaufbahnen und Abstürzen gelang jedoch keine Landung - auch den
amerikanischen Kollegen nicht.
Es war aber nur eine Frage der Zeit - dennoch eine so wichtige, daß die
Drehbuchautoren gleich den Einstieg in die Serie mit diesem Motiv
begannen.
Erst als die Raumpatrouille längst in der Post-Production war, gelangen Luna 9 und Surveyor 1 1966 "weiche" Mondlandungen.
Es hatte lange gedauert, bevor die Raumfahrtnationen (wie Cliff mit der
ORION) "die Behauptung erhärten" konnten, "daß eine Landung auf" dem
Mond (noch nicht "auf Rhea" :-) "möglich ist"...
Strafversetzungen ob dieser Mondlandungen sind nicht bekannt.
Die taube Nuß - Amerikanische Raumfahrt
Die Waffengattungen des US-Militärs waren sich Ende der 50er Jahre
keineswegs einig darüber, mit wessen Technik dem "kommunistischen
Sputnik" zu trotzen sei.
Heer und Marine stritten heftig über Zuständigkeiten, Kompetenzen und natürlich wer die bessere Raketentechnik besaß.
Ende Januar 1958 startete das Heer Explorer I. Mitte März folgte Vanguard 1 von der Marine.
Tatsächlich beendete erst die Gründung der NASA im Herbst desselben Jahres den Zwist.
Streit um Zuständigkeiten und Kompetenzen unter staatlichen Stellen auch
im Jahre 3000: Da paßt es der TRAV (Terrestrische
Raumaufklärungs-Verbände) nicht, wenn der GSD (Galaktischer
Sicherheits-Dienst) etwas vorschlägt. Daraus wird bestenfalls "ein
Debattierclub von Professoren und Militärs, die heute noch der Meinung
sind: Wir sind die Größten, wir sind die Gescheitesten und uns kann
keiner."
Umgekehrt verhört der GSD schon mal einen Commander der TRAV ohne seine Dienststelle zu informieren.
"Vanguard I", im März 1958 gestartet, war ein solarbetriebener
Minisatellit. Nur anderthalb Kilo schwer mit einem Durchmesser von
gerade 16 Zentimetern war er im Vergleich zum über 80 kg schweren
Sputnik nicht mehr als ein Fliegendreck - allerdings einer von der
hartnäckigen Sorte.
Vanguard I lebte 6 Jahre lang und piepste ununterbrochen nervig auf der
von beiden Raumfahrt-Nationen bevorzugten Frequenz von 108 MHz.
Eine kleine Vorwegnahme von Cliff's Retourkutsche an Tamara die ihm
verbot den ausgefallenen Sky-77 zu zerstören: "Diese kleine, taube Nuß,
die ihnen so sehr am Herzen lag, stört nämlich genau auf den Frequenzen,
die auf den Koordinaten [des automatischen Laborkreuzers] Challenger
liegen."
Evakuierung - Nur weg von diesen Politikern...
Die Superbombe, mit beliebiger Zerstörungskraft, ist das Ziel des
Rüstungswettlaufes zwischen UdSSR und Amerika in den 50er Jahren.
Dabei hat die Öffentlichkeit damals ganz andere Sorgen als immer noch
stärkere Bomben, angesichts Radioaktiven Staubes von oberirdischen
Atombombenversuchen in der Atmosphäre - was den Unterwasserwohnungsbau
attraktiv erscheinen ließ, doch dazu später mehr.
Erinnern Sie sich an Sir Arthur angesichts der auf die Erde zurasenden
Supernova: "Dann können sie auch sagen, was zum Teufel der oberste Rat
ab morgen auf den Marsmonden Deimos und Phobos zu suchen hat, wenn er
hier die Erdbevölkerung ihrem Schicksal überläßt?"
Hauptsache das eigene Hemd gerettet - eine damals in der Bundesrepublik unmögliche Einstellung von Politikern? Natürlich nicht!
Ende der 50er beschließt die deutsche Regierung einen milliardenteuren
gigantischen unterirdischen Atom-Bunker unter den Ahrweinbergen bei
Marienthal in der Nähe von Bonn zu errichten. Obwohl allgemein bekannt
versteht sich: Streng geheim. Von diesem Bunker aus sollte nach den
damaligen Vorstellungen Deutschland weiter regiert werden, während
draußen der Atomkrieg tobte.
Marschall Kublai-Krim wird es dereinst wunderschön formulieren:
"Politiker finden immer was zu regieren auch wenn schon längst nichts
mehr da ist!"
Kein Zufall, daß die Thematik des Atomkrieges 1963 im US-Film "Dr.
Seltsam oder Wie ich lernte die Bombe zu lieben" ebenfalls in der
Ohnmacht der Mächtigen gipfelt: Dasitzen und debattieren während draußen
die Apokalypse, der atomare Overkill, unaufhaltsam naht.
Inspiration für das traurige Kammerspiel das die Oberste Raumbehörde (ORB) während der Nova-Krise bietet.
Blick in den Regierungs-Atombunker
Der Regierungs-Atombunker, im Amtsdeutsch "Ausweichsitz der
Verfassungsorgane des Bundes im Krisen- und Verteidigungsfalle zur
Wahrnehmung von deren Funktionsfähigkeit" genannt, war nur für 3000 VIPs
aus Militär, Politik, Wirtschaft und Gesellschaft reserviert.
Nicht einmal die nächsten Angehörigen der "Geretteten" hätten darin Schutz suchen dürfen!
Offenbar war man besser vorbereitet als im Jahr 3000, wo Oberst Villa
angesichts eines hoffnungslosen Erd-Evakuierungsplanes bitter erklärt:
"Ich frage sie: Wer sind denn diese 0,25 Promille die überleben dürfen?
Wer wählt sie aus? Wer hat das größere Recht zu leben? Wollen Sie das
vielleicht entscheiden?"
Der Bunker wurde Ende der 50er geplant, 1971 fertig, 1997 aufgegeben.
Journalisten wollen herausgefunden haben, daß man in Regierungskreisen
der Sicherheit des Bunkers nie so recht traute und lieber auf
Evakuierungsplan B setzte: Ausfliegen nach Florida!
Phobos und Deimos lassen grüßen.
Zukünftig: Abgetaucht
Es hätte schon Möglichkeiten gegeben, eine zukünftige Umwelt zu
erstellen. Ein Flughafengebäude, entsprechend kaschiert als Raumhafen.
Futuristische Hochhausmodelle für die Stadt der Zukunft in den
Hintergrund einkopiert...
"Metropolis" hat es 1926 schon vorgemacht. Anregung fände sich genug.
War nicht gerade erst 1958 für die Expo in Brüssel mit dem "Atomium" ein
Bauwerk entstanden, daß ausgefallener kaum sein konnte? 1960 beschloß
Brasilien gar sich eine komplett auf dem Reisbrett entworfene neue
Hauptstadt zu bauen: Brasilia.
Die Architekten planten damals gänzlich neue Wohnkonzepte wie Riesenwohntürme, Terrassen- und Schachtelhäuser.
Hätten die Bühnenbauer statt der BlueScreen-Fische vor den Fenstern nicht noch andere Möglichkeiten gehabt?
Hochhaus-Skylines malen, Ausblicke auf Landschaften zeigen: von Wüste,
Gletscher bis Dschungel. Hat man die Kosten für eine Modellstadt
gescheut? Meinten Maler es sei unmöglich derlei kühne Entwürfe zu
realisieren?
Oder hat man nicht vielmehr mutig entschieden etwas noch ausgefalleneres
zu machen (ohne allerdings auch nur eine Unterwasser-Aussenaufnahme als
den Aufstieg des Raumschiffes ORION aus den Tiefen des Meeres zu
zeigen): Denn unter Wasser lag die Zukunft. Das zeigte sich damals
vielfach - es mußte sich in den Hinterköpfen der Drehbuchschreiber
festsetzen:
Hans Hass, einer DER Tauchpioniere schlechthin, prägte zusammen mit
seiner Frau Lotte Hass in vielen Büchern und Filmen die Vorstellungen
über die Unterwasserwelt in den 50er und 60er Jahren (z.B. "Under the
Red Sea", 1950).
Für "Unternehmen Xafira" erhielt er 1959 den Unterwasser-Oscar.
Auf der Kinoleinwand lief 1956 der Disney-Film "20.000 Meilen unterm Meer".
Das amerikanische Atom-U-Boot "Nautilus" tauchte 1958 als erstes unterm
Nordpol durch. 1960 stieg Professor Jacques Piccard in der von ihm
selbst gebauten "Trieste" tiefer als je ein Mensch vor oder nach ihm:
10.916m hinunter in den Marianengraben.
Mit "Schweigende Welt" entstand 1956 der erste Unterwasser-Farbfilm.
Gedreht von einem der bekanntesten Meeresforscher: Jacques Cousteau.
1959 erhielt er für "The golden Fish" den Kurzfilm-Oscar. Zu dieser Zeit
entwickelte er auch die "Diving Saucer" - eine Unterwasser-Untertasse
mit der zwei Personen 1000m tief tauchten - gerade als ob ein Diskus wie
die ORION elegant durch die Meerestiefen gleitet.
Cousteau war in vielerlei Hinsicht Visionär, so bei der Planung von
Unterwasser-Fischfarmen, Tauchfahrzeugen mit Greifern oder Fahrzeugen
für Erzabbau und Ölbohrungen am Meeresgrund.
1962 baute Cousteau mit der "Continental Shelf Station Nr. I" (ConShelf I)
das erste Unterwasser-Haus. In den folgenden 3 Jahren folgen mit ConShelf II
und III weitere Unterwasserlabors im Rahmen seines "Ocean Habitat Projects"
bei denen sogar ein ganzes Dorf entstand und 6 Leute 3 Wochen in 100m Tiefe
lebten. Tiefseebasis 104, der Startplatz des schnellen Raumkreuzers, schien
damals keineswegs so utopisch.
Interplanetare Wesen und Elektronengehirne
Erst 1957 begann die Elektrische Schreibmaschine ihren Siegeszug durch
die Büros - von Personal Computern oder gar
Osterei/Stachelei-Bordcomputern träumte damals keiner.
1960 erleuchten Halogenlampen die Nacht und der erste Laser wird
erfolgreich getestet - Strahlenwaffen und Lichtwerfer sind aber reine
SF.
1963 stellt die Ford Motor Company den ersten Industrieroboter vor. Der
"Unimat" hatte 2 pneumatisch angetriebene Teleskoparme mit 2
Greiffingern. Erinnert irgendwie an Gamma-7-Roboter, oder?
Irgendwann drehte es sich um und die Raumpatrouille beeinflußte die Realität:
1969 übertrug auch das deutsche Fernsehen die Mondlandung. Noch waren
die Astronauten nicht ausgestiegen. Zuschauer konnten dem Experten im
Studio Fragen stellen. Es kam folgende Telefon-Frage: "Sind die
Raumfahrer bewaffnet? Wie wehren sie sich, wenn es zu kriegerischen
Auseinandersetzungen mit interplanetaren Wesen kommt?"
Zuviel Raumpatrouille geguckt? ;-)
Starlight Info:
Recherche und Text: M.Höfler, 6/2001

Die taube Nuss (Kommunikationssatellit)

Europäische Union
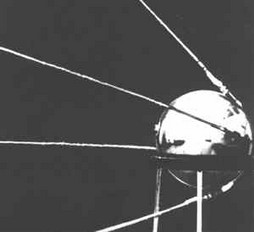
Sputnik

Tereschkowa und Kollegen

Landung auf Rhea
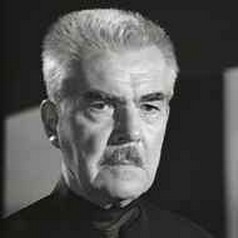
Sir Arthur

Büroturm

Terrassen-Häuser

Schachtel-Häuser

Atomium

Hans Hass

Jacques Cousteau

Tauchfahrzeug

Bordcomputer der ORION

Roboter

Mondlandung